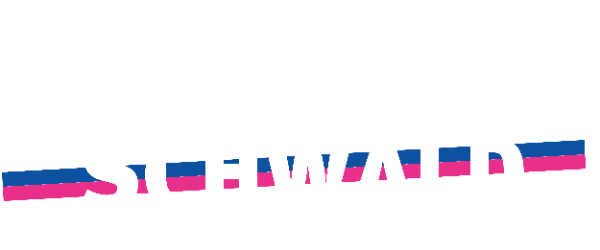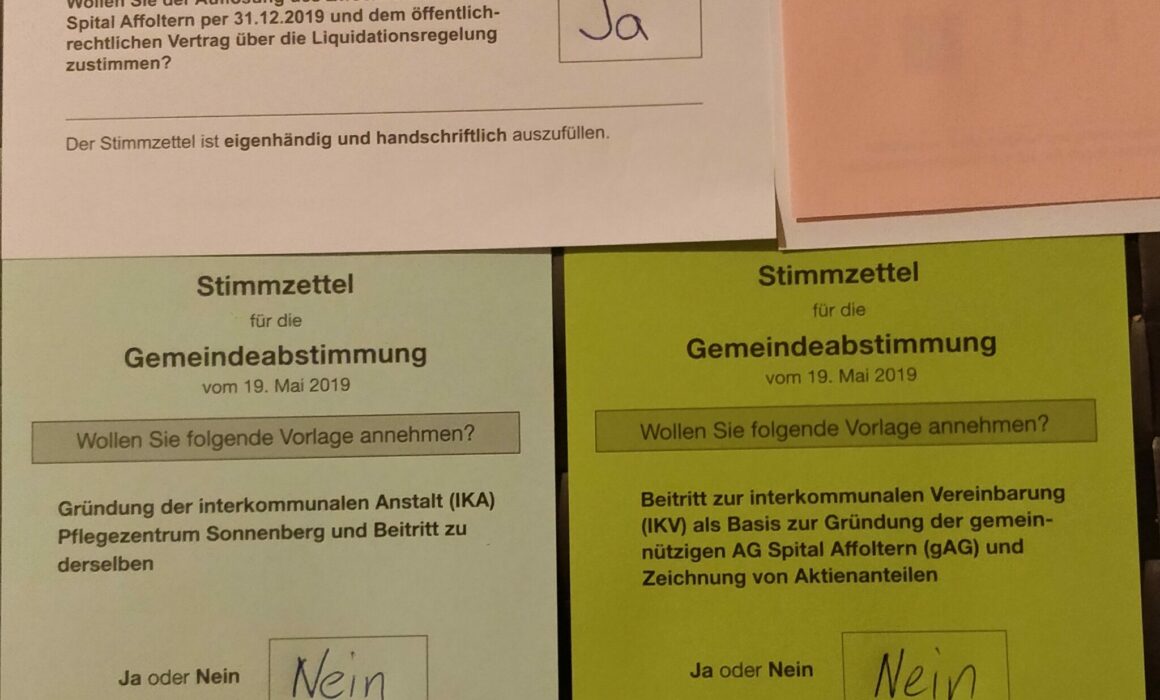Die Erpressung der Liberalen
Zwei Themen dominieren 2019 die politische Agenda in der Schweiz: Die Klimastreiks und das Rahmenabkommen. Seit Monaten wird in Bundesbern heftig über das vorliegende Rahmenabkommen mit der EU debattiert und gestritten. Dabei haben sich die liberalen Kräfte, um die FDP und die Grünliberalen in eine heikle Position manövriert. Teils durch eignes zutun, teils durch unglückliche Umstände. Zum einen war das Vorgehen von Bundesrat Cassis im letzten Sommer bzgl. Lohnschutz kommunikativ und strategisch ungeschickt. Zum anderen sind die liberalen Kräfte durch die Totalopposition der SVP eh schon in einer schwierigen Situation.
Nach Jahren des Dornröschenschlafes haben die Linken und Gewerkschaften die verflixte Position der liberalen Kräfte wiederentdeckt und versuchen sie für sich zu nutzen. Sie wissen haargenau ohne die Linken ist das Rahmenabkommen tot. Der tollpatschige Versuch von Cassis im Sommer 2018 eine Lösung beim Lohnschutz zu finden, gab den Linken den Anlass ihre Ausgangslage in politisches Kapital zu verwandeln. Seither gehen sie in Sachen Lohnschutz auf die Barrikaden. Dass die Linken in diesem Punkt irgendwann nachgeben werden, ist zwar jetzt schon mehr oder weniger klar. Die Frage ist nur zu welchem Preis. Was können die Linken im Gegenzug von den Mitteparteien für Zugeständnisse erpressen? Das Ziel ist klar: Die Amputation des liberalen Arbeitsmarktes durch Mindestlöhne oder die Ausweitung von Gesamtarbeitsverträgen.
Ob sich die Mitteparteien auf diese Erpressung einlassen sollen, sollte gut überlegt sein. Das vorliegende Rahmenabkommen aus liberaler Sicht durchaus kritisch zu sehen ist. Das Schiedsgericht verkommt durch die Rolle des EuGHs zum Feigenblatt, es droht die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie und auch über dem Freihandelsabkommen hängt das Damoklesschwert des Rahmenabkommens. Lässt man sich auf die Erpressung ein, so ist man auch in Zukunft nicht vor solchen Erpressungen durch die Linken geschützt. Um solche Erpressungen in der Europapolitik dauerhaft zu entgehen gibt es eigentlich nur einen Weg. Einen Schritt auf die SVP zu machen und sich langfristig vom bilateralen Weg, welcher laut der EU sowieso zu Ende ist, zu lösen. Wie ein solcher Weg aussehen könnte, macht gerade Kanada vor, welches mit der EU einen Freihandelsabkommen abgeschlossen hat.