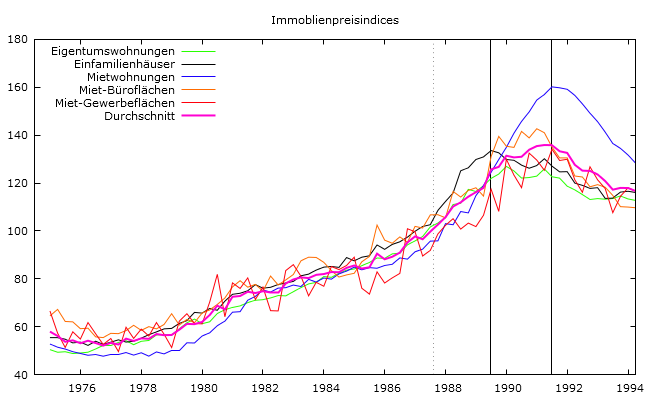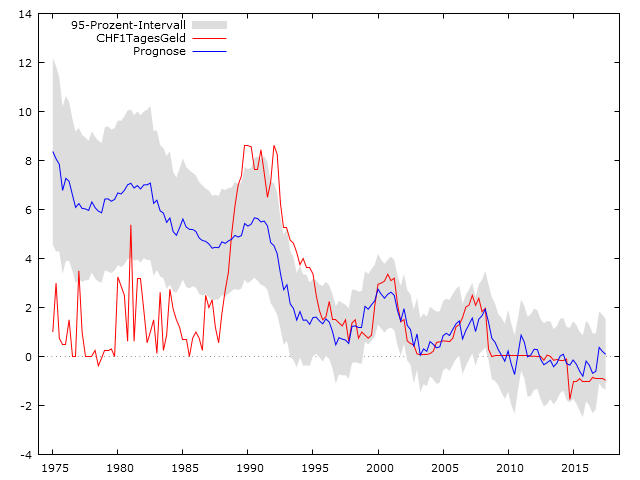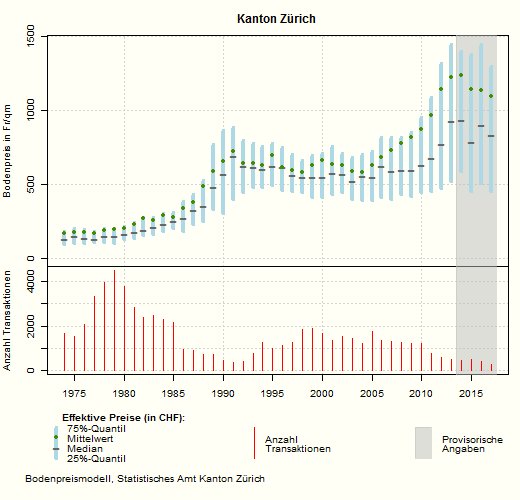Das neue Wassergesetz berücksichtigt verschiedene Anliegen
Das Wassergesetz ist ein Kompromiss, welcher vielen verschiedenen Ansprüchen aus der Gesellschaft und der Umwelt Rechnung trägt. Das Gesetz bringt wesentliche Vorteile in Bezug auf Naturschutz und Gewässerqualität. Erstmals wurden ökologische Anliegen im kantonalen Wasserrecht verankert. Eine sichere Wasserversorgung als zentraler Teil einer funktionierenden Infrastruktur ist auch für Unternehmen von hoher Bedeutung. So wurden auch die Bedürfnisse des Gewerbes im neuen Wassergesetz berücksichtigt. Ebenfalls profitieren die Mieter und Hauseigentümer vom neuen Wassergesetz. Für die Hauseigentümer ist wichtig, dass das neue Gesetz Rechtssicherheit gewährleistet. Davon profitieren auch die Mieter: So bleiben die Mieten stabil und die Infrastruktur intakt. Des Weiteren berücksichtigt das neue Gesetz auch die Interessen der Gemeinden. Es gelang, ein Gesetz zu schaffen, das die Gemeindeautonomie und den Grundsatz der Subsidiarität respektiert. Das Gesetz ermöglicht eine zeitgemässe Nutzung von Wasser bei gleichzeitigem Schutz der Gewässer und der Umwelt. Die Gegner des neuen Gesetzes – insbesondere die SP – behaupten, dass das Gesetz Tür und Tor öffne für die Privatisierung unseres Wassers. Dies ist nachweislich falsch! Das heute geltende Gesetz erlaubt den Gemeinden ihre Wasserversorgung vollständig zu Privatisieren. Mit dem neuen Wassergesetz wäre dies nicht mehr möglich: Allfällige private Beteiligungen werden auf maximal 49 Prozent beschränkt – die Stimmrechte sogar auf 33 Prozent. Das Wassergesetz gewährleistet eine sichere öffentliche Wasserversorgung für alle. Sagen Sie Ja zum neuen Wassergesetz.